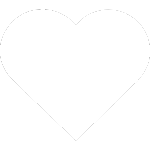Asymmetrie in der Rechtsdurchsetzung
Viele Schäden, die Unternehmen den Verbraucher:innen verursachen, sind, bezogen auf den Einzelfall oft von so geringem Ausmaß, dass sich der Aufwand zur Durchsetzung der Rechtsansprüche individuell nicht lohnt. Verstärkt wird dies durch die ungleiche Ausstattung mit finanziellen und juristischen Ressourcen: Unternehmen verfügen in ungleich höherem Umfang über diese Ressourcen und verfügen über ein weitaus höheres Maß an Erfahrungen mit juristischen Verfahren. Zusätzlich wird die Asymmetrie in der Rechtsdurchsetzung durch den ungewissen Ausgang von Gerichtsverfahren verstärkt. Die Asymmetrie in der Rechtsdurchsetzung verschafft den Unternehmen einen strukturellen Vorteil bei der Verfolgung ihrer Rechtsinteressen.
Das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Verbraucher:innen und Unternehmen ist der marktwirtschaftlich ausgerichteten Wirtschaftsordnung immanent. "Strukturell" bedeutet hier, dass in der Marktwirtschaft schon die "Rollen" der beiden Marktakteure (Unternehmen und Verbraucher:innen) so angelegt sind, dass deren Unterschiedlichkeit den Verbraucher:innen Nachteile einbringt und in der Benachteiligung der Verbraucher:innen mündet (strukturelle Benachteiligung).
Das strukturelle Ungleichgewicht beruht auf den folgenden fünf Asymmetrien:
- Asymmetrie in der Rechtsdurchsetzung
- Organisationsasymmetrie
- Machtasymmetrie
- Informationsasymmetrie
- Wissens- und Machtasymmetrie

Organisationsasymmetrie
Die zweite Asymmetrie des strukturellen Ungleichgewichts zwischen Verbraucher:innen und Unternehmen besteht in der ungleichen Möglichkeit, eine durchsetzungsfähige Interessenvertretung selbstorganisiert zu etablieren.
Einerseits ist das gemeinsame Interesse der Verbraucher:innen nach wirtschaftlicher Selbstbestimmung so abstrakt, dass eine Organisation nur mit sehr hohem Ressourceneinsatz oder gar nicht möglich ist. Andererseits sind auf individueller Ebene die Interessen der Verbraucher:innen so spezifisch, dass die Organisation zu einer wirksamen Interessenvertretung nur sehr eingeschränkt (und allenfalls auf ein spezifisches Interesse ausgerichtet) möglich ist. Unternehmen verfügen hingegen über weit homogenere Interessen als Verbraucher:innen, die eine Mobilisierung einzelner Unternehmen zu Verbänden ermöglichen. Diese Organisationsasymmetrie verschafft den Unternehmen einen strukturellen Vorteil bei der Organisation der Vertretung ihrer politischen Interessen.
Machtasymmetrie
Die dritte Asymmetrie des strukturellen Ungleichgewichts zwischen Verbraucher:innen und Unternehmen besteht in den ungleichen Möglichkeiten, politisches Gehör zu finden. Grundsätzlich sind Unternehmen besser als Verbraucher:innen mit finanziellen und personellen Ressourcen für die Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Interessen ausgestattet, um sich Zugang zu politischen Entscheidungsträger:innen zu ermöglichen. Zudem verfügen sie über ein Drohpotential (z.B. Arbeitsplätze, Abwanderung, Steuern), das in der politischen Diskussion weit höher gewichtet wird, als das einer Verbraucher:in. Diese Machtasymmetrie verschafft den Unternehmen einen strukturellen Vorteil bei der Verfolgung ihrer politischen Interessen.
Informationsasymmetrie
Eine individuell bedarfsgerechte Entscheidung ist Verbraucher:innen nur möglich, wenn sie vollständig über die Produkt- und Prozesseigenschaften der angebotenen Waren und Dienstleistungen informiert sind. Dazu ist es notwendig, dass sie das Vorhandensein sowie die Ausgestaltung der versprochenen Produkt- und Prozesseigenschaften verifizieren können. Allerdings können Verbraucher:innen die unterschiedlichen Produkt- und Prozesseigenschaften nicht in gleichem Ausmaß und nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten verifizieren. Diese Problematik bringt die informationsökonomische Eigenschaftstypologie zum Ausdruck: Je nach Zeitpunkt einer möglichen Verifikation durch den Verbraucher:in grenzt die informationsökonomische Eigenschaftstypologie drei Eigenschaftskategorien Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften gegeneinander ab:
- Sucheigenschaften sind die Produkteigenschaften, die Verbraucher:innen zum Zeitpunkt des Kaufes am Produkt direkt verifizieren können.
- Erfahrungseigenschaften sind die Eigenschaften, die für Verbraucher:innen nach dem Kauf im Gebrauch erfahrbar sind.
- Vertrauenseigenschaften sind die Eigenschaften eines Produktes, die den Verbraucher:innen weder zum Zeitpunkt des Kaufes noch danach bekannt werden.
Unternehmen ist bei ihren Produkten und Dienstleistungen hingegen das Vorhandensein aller drei Eigenschaftskategorien stets bekannt. Bei Vertrauenseigenschaften haben Unternehmen zudem einen Anreiz sich opportunistisch zu verhalten und so Verbraucher:innen über Produkt- und Prozesseigenschaften zu täuschen. Unternehmen besitzen damit einen strukturellen Informationsvorsprung gegenüber Verbraucher:innenn, der zudem bei Vertrauenseigenschaften dauerhaft bestehen bleibt.
Wissens- und Machtasymmetrie
(Strukturelles Ungleichgewicht in der Digitalökonomie)
Das Geschäftsmodell der Digitalökonomie beruht auf der Aneignung und Auswertung aller digitalisierten und digitalisierbaren Verhaltensdaten der Verbraucher:innen (Nutzer:innen). Unter Verhaltensdaten sind dabei die Daten zu verstehen, die Unternehmen von Verbraucher:innen sammeln/extrahieren. Diese sind neben den klassischen Daten wie der IP-Adresse und Seitenaufrufe auch Gesundheitsdaten, Daten zum Fahrverhalten, Daten zu den Haushaltsausgaben, Aufenthaltsorte und viele mehr.
Die Auswertung der angeeigneten Daten, bei der auch Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander verschnitten werden, dient der Verhaltensbeobachtung und Verhaltenssteuerung. Insofern sind die Verbraucher:innen in der Digitalökonomie weder „König“ noch das "Produkt", sondern die Rohstoffquelle.
In der Digitalökonomie verschärft sich also das strukturelle Ungleichgewicht: Während die Unternehmen der Digitalökonomie, zu denen alle Unternehmen zu zählen sind, die Daten extrahieren/sammeln, d.h. vor allem - aber nicht nur - die großen Tech-Unternehmen, über das Verhalten der Verbraucher:innen informiert sind, stehen Verbraucher:innen vergleichbare Informationen noch nicht einmal zur Verfügung bzw. nur mit erheblichem Aufwand und allenfalls sehr eingeschränkt. Verbraucher:innen mögen zwar von einzelnen Unternehmen erfahren können, welche Daten diese sich über sie angeeignet haben, wie aber diese ausgewertet und zur Verhaltenssteuerung eingesetzt werden, erfahren Verbraucher:innen dadurch nicht. (Gerne werden diese Informationen als Betriebsgeheimnisse "geschützt".)
Mit diesem Wissen über das Verhalten der Verbraucher:innen und der Möglichkeit, die Algorithmen zu schreiben und zu verändern, die darüber bestimmen, was Nutzer:innen zu sehen bekommen, bestimmen die Unternehmen der Digitalökonomie darüber, als was sich die digitale Welt den Nutzer:innen präsentiert (was Nutzer:innen zu sehen bekommen und was nicht). Auf diese Weise üben die Digitalunternehmen einen verzerrenden Einfluss auf die Informationsumwelt und damit auf die Informationen aus, die in das Entscheidungsverhalten der Verbraucher:innen eingehen (können).
Literatur
Jaquemoth, M.; Hufnagel, R. (2018): Verbraucherpolitik. Stuttgart : Schäfer-Pöschel, S. 90.
Tamm, M. (2011): Verbraucherschutzrecht - Europäisierung und Materialisierung des deutschen Zivilrechts und die Herausbildung eines Verbraucherschutzprínzíps. Tübingen : Mohr Siebeck.
Zuboff, S. (2018): Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Frankfurt/New York : Campus Verlag.
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, des Warenzeichengesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes. Begründung, Nr A.I.2, S. 4. BT-Drucksache IV/2217 (29. April 1964).
Graham, T.; Andrejevic, M. (2024):A computational analysis of potential algorithmic bias on platform X during the 2024 US election. Working paper. Online verfügbar unter https://eprints.qut.edu.au/253211/, zuletzt aufgerufen am 13.01.2025.